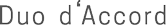Wie habt ihr euch kennengelernt?
An der Münchner Musikhochschule. Wir haben beide in der Klasse von Karl-Hermann Mrongovius studiert und hatten jede Woche direkt nacheinander Unterricht.Wann fing es mit dem Duo an?
Das war Ende 1999. Lucia hatte schon lange den großen Wunsch, Klavierduo zu spielen und fragte Begoña Uriarte, die für uns genauso prägend war wie Karl-Hermann Mrongovius, wer ein guter Partner sein könnte. Ihr Rat war, es mal mit Sebastian zu probieren... in den ersten beiden Jahren bekamen wir dann Unterricht von beiden, was ein unendlich wertvoller Grundstein für unser Duo war.Ganz schön waghalsig, so kurz nach der Gründung gleich an den zwei bedeutendsten Wettbewerben – ARD in München und Murray Dranoff in Miami – teilzunehmen...
Ja klar, andererseits war es ein wirklich motivierendes Ziel. Bis zum ARD-Wettbewerb blieben uns ziemlich genau 9 Monate, und für Murray Dranoff – mit anderem Repertoire – dann ein Jahr. Lucia hatte zudem ihre Dozentur in Innsbruck und einen Lehrauftrag in München, Sebastian war noch Student und mußte eigentlich seine beiden Abschlüsse (Klavier und Schulmusik) vorbereiten. Das trieb uns teilweise über unsere Belastbarkeitsgrenze, zeigte uns aber gleichzeitig unser Potenzial – musikalisch und im Miteinander.Haben die Preise den Weg für Eure Karriere geebnet?
Vor allem viele Türen geöffnet, allein durch die Konzerteinladungen, die damit verbunden waren: da mußten wir natürlich sofort alles auf sehr hohem Niveau präsentieren, was eine harte, aber gute Schule war. Was die Karriere betrifft, helfen solche Konzerte nur bedingt, denn man tritt dort in erster Linie als Wettbewerbs-Preisträger auf. Im nächsten Jahr spielt dann der nächste Preisträger... Wettbewerbe sind sehr wichtig für einen selbst, haben aber keine Nachhaltigkeit mehr, weil es mittlerweile sehr viele davon gibt. Wenn man das weiß und damit umgehen kann, bringen sie einen aber auf jeden Fall weiter.Muß man sich sehr nahestehen, verwandt oder verheiratet sein, um Klavierduo zu spielen?
Sicher hilft es. Das Klavierduo erzeugt ab einem gewissen Punkt große Nähe und durchaus auch Intimität, vor allem beim vierhändigen Spiel, wo man sich ein Instrument teilt und dadurch auch relativ eng zusammen sitzt. Für uns beide ist das Klavier aber auch ein Ort, wo man nicht automatisch in Harmonie aufeinander trifft. Kann man diese Spannungen zusammenbringen und kanalisieren, gewinnt die Musik letztendlich sehr. Aber man gelangt nur an diesen Punkt, wenn man eine stabile Beziehung zueinander hat.Wie übt bzw. probt ihr? Übt ihr alles zusammen?
Jeder übt erstmal seinen eigenen Part, bis er ihn beherrscht, das große Ganze überschauen kann und seinen Interpretationsansatz hat. Dann setzen wir uns erst zusammen, erkunden gemeinsam die Musik. Ab diesem Zeitpunkt passiert das musikalische Arbeiten hauptsächlich im Duo, das pianistische Ausfeilen bestimmter Passagen macht jeder für sich.Was ist der Unterschied zwischen Musik für zwei Klaviere und vierhändig?
Den einen Unterschied gibt es für uns nicht. Klar könnte man sagen: zwei Klaviere sind eher konzertant-virtuos, vierhändig eher kammermusikalisch-intim, und es wäre genauso leicht, Werke zu finden, um diese These zu belegen. Wenn man es aber tatsächlich so sieht, engt man sich wahnsinnig ein, und sehr viele Komponisten haben in ihren Duo-Werken eine Ebene geschaffen, der man weder mit der einen noch mit der anderen Etikette gerecht werden kann. Letztlich ist gute Musik für Klavierduo vor allem Musik, die nun mal nur von zwei Pianisten gespielt werden kann. Deswegen unterscheiden wir nur Werke, von denen wir überzeugt sind oder eben nicht, das Medium spielt dabei keine Rollle.Aber es muß doch auch fassbare Unterschiede geben?
In der Spielart, in der Klangmischung, Pedalisierung, Kraftdosierung etc. auf jeden Fall, darin sind die Unterschiede sogar enorm. Es gibt Duos, die sich bewußt für das Eine oder Andere entscheiden, bei uns waren beide Formationen von Anfang an gleichwertig und gleich geliebt. Das Wechseln von einem auf zwei Klaviere ist im Konzert auch für das Publikum reizvoll, deshalb gestalten wir sehr gerne Programme mit beiden Elementen, wenn es inhaltlich passt.Es wird behauptet, für Klavierduo wäre das Repertoire recht beschränkt...
Im Vergleich zu Klavier solo stimmt das, aber welches Instrument kann da schon mithalten? Im Vergleich zu allen anderen Instrumenten und Kammermusikbesetzungen hat Klavierduo sogar eins der größten Originalrepertoires, dazu kommen noch viele Transkriptionen.Bestimmt ihr selbst die Konzertprogramme oder die Veranstalter?
In der Regel machen wir die Programme selbst. Festivals sind die Ausnahme, sie haben oft ein Motto und manchmal dementsprechende konkrete Wünsche. Auf diese Weise hatten wir z.B. die große Freude, beim Beethovenfest Bonn die „Three Dances“ für zwei präparierte Klaviere von John Cage spielen zu können, mitten in einem „normalen“ Duo-Abend – da standen also insgesamt vier Flügel auf der Bühne!Eine Besonderheit Eurer Konzerte ist, dass ihr sie meistens moderiert, warum?
Wir sehen uns nicht als Pianisten im Elfenbeinturm, wir reden gerne mit unseren Zuhörern. Außerdem sehen wir das Moderieren als eine wichtige geistige Brücke hin zur klassischen Musik.Aber gute Musik bedarf eigentlich doch keiner Erklärung?
Wir erklären nichts, wir stellen eigentlich nur einen Bezug her zu etwas anderem. Wenn man z.B. weiß, dass die Werke von Carl Maria von Weber, die aus heutiger Sicht so vertraut romantisch klingen, zu einer Zeit entstanden sind, in der es die deutsche Romantik in dem Sinn noch gar nicht gab, dann hört man ganz anders zu.Ihr bearbeitet auch Werke, die für andere Besetzungen komponiert wurden. Wenn nicht aus Repertoirenot, warum dann?
Aus dem großen Bedürfnis heraus, auch andere großartige Musik selbst zu spielen. Dabei gehen wir aber sehr respektvoll vor und wählen nur solche Werke aus, die als Klavierstücke „funktionieren“, also der Natur des Instruments entsprechen. Die Versuchung ist nämlich sehr groß, für zwei Pianisten ist technisch gesehen alles machbar.Bearbeitungen werden manchmal mit Skepsis betrachtet...
Eben aus diesem Grund: von den Tönen her ist es machbar, aber der Klang stimmt halt nicht und darum überzeugt es nicht. Im 19. Jahrhundert mag das noch etwas anderes gewesen sein: damals ging es vor allem um Verbreitung neuer Werke und daher wurde von fast jedem Orchester- oder sonstigem Werk eine vierhändige Fassung erstellt: logisch, daß da viel Durchschnitt herauskommt. Eine wirklich gute Bearbeitung ist aber eine tolle Sache, selbst wenn sie gewagt scheint – nehmen wir zum Beispiel Liszts Zwei-Klaviere-Fassung von Beethovens 9. Symphonie. Zuerst dachten wir: das ist doch völlig unmöglich, allein schon wegen der Schlußnummer, in der bei Beethoven noch der Chor und die Gesangssolisten dazukommen. Aber es ist bei Liszt schlicht und einfach gute Klaviermusik geworden, die einen unglaublich packt.Wer sind eure Lieblingskomponisten?
Das wechselt, aber meistens sind es die Komponisten, deren Werke sich im Lauf der Jahre zwischen uns weiterentwickeln, verändern und wachsen, das erleben wir gerade zum Beispiel mit der Brahms-Sonate und Ravels La Valse. Diese tiefe Vertrautheit schafft dann noch einmal eine besondere Bindung zum Komponisten.Ihr mischt oft zeitgenössische Stücke ins Programm. Gehört das nicht eher in andere Veranstaltungsrahmen für ein speziell geschultes Publikum?
Im Gegenteil: ein neues Stück im Programm bringt auch frischen Wind in die Klassiker. Außerdem sind gute zeitgenössische Komponisten unersetzlich, sie bringen Dinge zum Ausdruck, die in unserer wunderschönen und gleichzeitig grauenhaften Gegenwart und Gesellschaft passieren, und das ist auch eine Aufgabe von Musik. Manche Zuhörer staunen hinterher oft selber, dass das zeitgenössische Stück sie am meisten angesprochen hat.Es sind ja auch schon mehrere Stücke für Euch geschrieben worden, wie kam das?
So etwas beginnt immer mit einer Frage, entweder vom Komponisten oder von uns. So oder so ist es eine tolle Sache und eine große Ehre, wenn ein Stück speziell für uns geschrieben wird und wir dann mit dem Komponisten arbeiten können. Besonders wichtig finden wir es, daß diese neuen Werke mehr als nur einmal gespielt werden, deswegen bauen wir sie auch noch Jahre danach immer wieder mal in Konzerte ein.Ist es eigentlich schwierig, als Paar so eng miteinander zu arbeiten?
Das kann man nicht allgemein beantworten, denn jedes Paar ist anders. Wir beide empfinden die starke Präsenz des anderen nicht als etwas Einengendes, sondern als etwas Erweiterndes und auch Entlastendes. Außerdem, auch wenn wir einen großen Teil unserer Zeit miteinander verbringen, leben wir dennoch zwei Leben und nicht eines.Ihr unterrichtet sogar beide am gleichen Institut, war das geplant?
Im Bereich der universitären Musikausbildung sind die Klavierstellen dünn gesät, und daß wir beide in Innsbruck lehren, hat sich einfach so ergeben. Mittlerweile hat es sich als Glücksfall erwiesen, auch für die Studenten: jeder von uns leitet eine autarke und ganz „normale“ Solo-Klasse, aber unsere Studenten kennen sich alle, haben einen guten Austausch und können alle voneinander etwas lernen. Das Arbeitsklima ist harmonisch, und wir stellen immer wieder gemeinsame Projekte auf die Beine.Unterrichtet Ihr dort auch Klavierduo?
Ab und zu im Rahmen von Kammermusik, aber ein festes Duo auszubilden ist und war nie unsere Absicht, wir verstehen unsere Aufgabe am Konservatorium auch nicht so. Im Moment spielen zwei unserer Studenten zwar tatsächlich längerfristig zusammen und wir unterstützen sie, weil sie wirklich begabt sind. Wahrscheinlich wird das aber die berühmte Ausnahme bleiben, die die Regel bestätigt.Was bedeutet Euch dann die pädagogische Tätigkeit, nimmt die nicht Zeit vom Üben und Konzertieren weg?
Wir haben uns bewußt dafür entschieden, denn wir sehen beide das Unterrichten als logische Ergänzung zum eigenen Spielen, die eine andere Herangehens- und Denkweise anregt. Und wenn man die Arbeit mit den Studenten ernst nimmt, bekommt man auch auf der persönlichen Ebene viel zurück für die Energie, die man einbringt.Ihr habt eine kleine Tochter. Inwieweit ist Familienleben und Künstler-Dasein denn kompatibel?
Wir finden unser Leben schön, gerade weil es durch unsere Tochter etwas ganz Normales bekommen hat, das einen jeden Tag erdet. Für uns alle sind Musik, Konzerte, Proben, Hotels, Zugfahrten und Transkontinentalflüge etwas, das selbstverständlich dazugehört, genauso wie auf der anderen Seite der Spielplatz und Kindergarten, das Spielen, Lesen, Blödsinn machen, kuscheln und einfach miteinander als Familie sein. Das bedeutet viel Organisation und sicher auch Verzicht auf manches, das man früher unverzichtbar fand, aber wir sehen uns da letztlich in einer Reihe mit allen anderen Eltern: wenn man ein Kind hat, dann ist es einfach so. Alles verändert sich – und wir finden, zum Besseren.Spielt Eure Tochter auch Klavier?
Nein, sie liebt Harfe. Als sie uns das zum ersten Mal gesagt hat, war sie vier Jahre alt und wir total verblüfft! Aber sie hat da nicht locker gelassen und spielt jetzt seit einem halben Jahr. Den ersten Berufswunsch hat sie auch schon: entweder Harfenistin oder Eiskünstlerin werden, die aus Eis Skulpturen macht.Mit zwei konzertierenden Musikern als Eltern liegt es doch nahe, dass auch Eure Tochter mal Musikerin werden möchte?
Sebastian sagt immer, hoffentlich lernt sie lieber was Gescheites... im Ernst, sie müßte uns dann erst mal mit Beharrlichkeit und Talent überzeugen. Musiker ist einer der schönsten Berufe, braucht aber sehr viel Selbstdisziplin, langen Atem, viel Glück und außerdem einen robusten Magen. Aus Familientradition alleine sollte niemand diesen Beruf ergreifen. Wenn sie es später wirklich will, hat sie natürlich unsere Unterstützung, momentan stufen wir es aber ähnlich ein, wie wenn Jungs Feuerwehrmann werden möchten.Warum seid ihr eigentlich nicht auf Facebook oder Twitter?
Diese Art von Kommunikation paßt einfach nicht zu uns, jedenfalls bis jetzt. Reden, telefonieren und e-mails finden wir besser, denn die sozialen Netzwerke haben durchaus ihre Tücken, bei aller Schnelligkeit, Fotofreude und dem guten Gefühl, immer am Ball zu sein. Von Big Data und dem Suchtpotenzial des Smartphones mal ganz abgesehen: wir spüren eine beginnende Hohlheit und Verflachung darin, wie die Menschen aufeinander zugehen und miteinander umgehen, und das gefällt uns nicht. Brian Eno hat es einmal sehr gut ausgedrückt: „Mir fällt auf, dass ich mit mehr Menschen kommuniziere, aber weniger eingehend. Mir fällt auf, dass es möglich ist, vertrauliche Beziehungen zu haben, die nur im Netz existieren und wenig oder gar keine körperlichen Bestandteile aufweisen. Vom Wert dieser Veränderungen bin ich nicht überzeugt.“
Lucia Huang & Sebastian Euler, Mai 2015
Die Fragen stellte Henri Ducard